Dieser Text ist eine erweiterte Version dieses Twitter-Threads vom 20.5.2021 über das Projekt „Ich bin Sophie Scholl“.

Auf Instagram läuft seit einer Weile das Projekt @IchBinSophieScholl des SWR und BR. Darin schlüpft eine Schauspielerin in die Rolle der Sophie Scholl und tritt mit ihren Follower:innen in Interaktion – ganz wie eine Influencerin.
Nun kann ich wohl glaubwürdig behaupten, dass ich nicht grundsätzlich gegen Projekte bin, in denen so getan wird, als würde eine historische Person einen Social-Media-Account betreiben. Als Begleitung zum Reisetagebuch der Anna Pappritz habe ich auf dem Twitter-Account @PappritzOnTour Ähnliches getan. Wenn ich @IchBinSophieScholl dennoch kritisiere, so ist das keine Pauschalkritik an kreativen Formen der Geschichtsvermittlung, sondern an der Ausführung dieses einen Experiments, das für meine Begriffe schon kurz nach seinem Start zu scheitern droht – wenn es keine Kurskorrektur gibt.
Viel Erhellendes wurde dazu bereits gesagt – etwa von der Historikerin Fabiana Kutsche, der Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier oder der Autorin Nora Hespers, von der in der Sache sicher noch mehr zu hören sein wird. Ich will mich also auf einige persönliche Bemerkungen beschränken.
Social Media als historische Persönlichkeit – kann das gehen?
Als ich die Idee hatte, mir mit @PappritzOnTour einen Spaß zu machen, der niedrigschwellig etwas Wissen vermittelt, zweifelte ich zunächst. Kann das gehen? Kann es mehr sein als Rollenspiel? Passt es zu meinem Anspruch, keine „Heldinnengeschichte“ schreiben zu wollen? Ich kann als twitternde Anna Pappritz ja nicht kontextualisieren. Alles, was rausgeht, steht erst mal ohne Kontext im Netz. Das ist unproblematisch, wenn es um Landschaftsbeobachtungen oder lustige Bemerkungen über die nackten Füße der männlichen Mitreisenden geht.
Aber als weiße, reisende Frau um 1900 hatte Anna Pappritz auch Einstellungen, die wir heute unbedingt kontextualisieren und kritisch einordnen müssen. Das Tagebuch, auf dem die Tweets basieren, enthält rassistische Aussagen. Diese kann ich weder twittern noch weglassen, denn Weglassen würde ein verzerrtes, reingewaschenes Bild von Anna Pappritz vermitteln.
Drei Regeln als Grundlage
Ich gab mir deshalb drei Regeln, von denen ich hoffe, dass sie ihrem Anspruch halbwegs genügten:
- Texttreue. Alle Tweets sind entweder direkte Zitate oder Zusammenfassungen direkter Zitate. Ich kenne Anna Pappritz‘ Sprachgebrauch aus zahlreichen Originaldokumenten, aber ich lege ihr keine Worte in den Mund. Gut, zugegeben: Eine Ausnahme habe ich mir gegönnt – aber da hat sie wirklich eine Steilvorlage gegeben, an der ich nicht vorbeilaufen konnte.
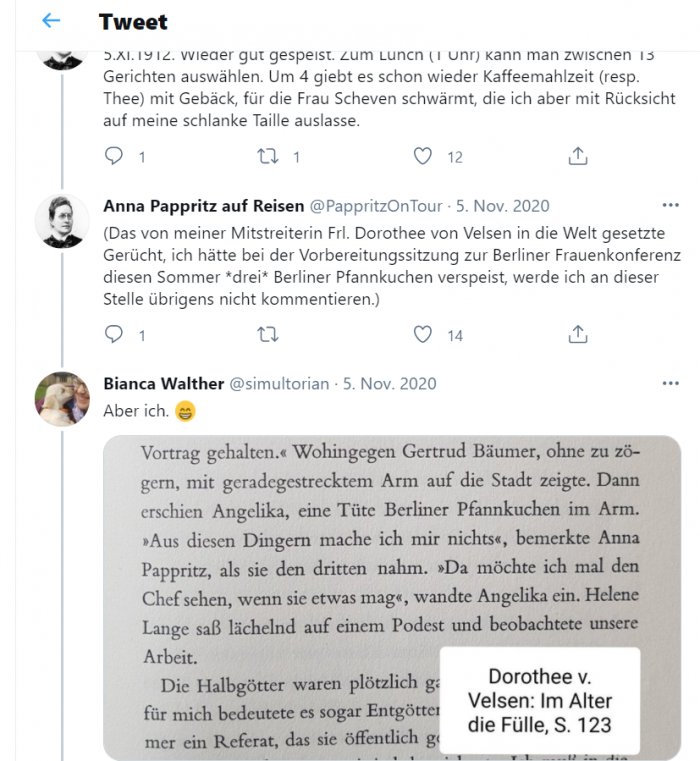
- Kontext und eine Erzählerin. Es gibt ein Internetdossier, einen Podcast, gelegentliche Einwürfe der „Schreibkraft“, die über Pappritz in der 3. Person twittert.
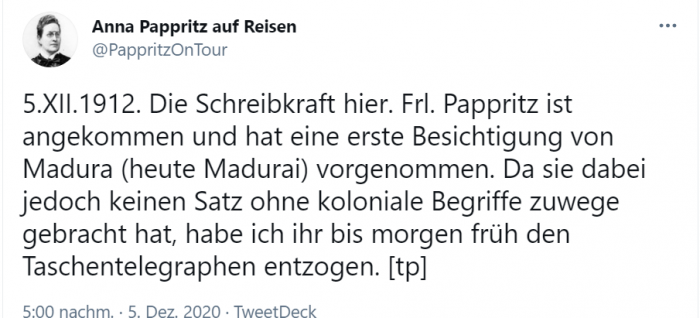
- Niemals als Anna Pappritz interagieren! Damit wäre sofort die Grenze zur Spielerei überschritten, und jedes Bemühen um die notwendige kritische Distanz würde zunichte gemacht.
Nun war das ein kleines Projekt, und man mag sagen, wer zigtausende „junger Menschen“ erreichen will, muss anders unterwegs sein. Aber ist das so? Und wenn ja, zu welchem Zweck? Um uns das wohlige Gefühl zu vermitteln, die historischen Akteur:innen seien unsere Freund:innen?
Reichweite ist nicht alles
Das ist aber doch genau der Ansatz, den wir in der Geschichtsschreibung überwinden wollen. Die Identifikation mit Akteur:innen der Vergangenheit kann zu bequemem Zurücklehnen in dem Gefühl, man sei „auf der richtigen Seite der Geschichte“. Es verleitet dazu, die Person, die man doch so liebgewonnen hat, in Schutz zu nehmen gegen vermeintliche Angriffe wenn jemand doch einmal Kontextualisierung für nötig hält.
Und genau das ist (auch) meine Kritik an @IchBinSophieScholl. Die Kommentare unter den Insta-Posts zeigen, dass genau der genannte Effekt eintritt. Mitlesende identifizieren sich als Freundin von Sophie, unterscheiden zu wenig zwischen Kunstfigur und realer Person (wie auch, wenn einige Aspekte der realen Person kaum thematisiert werden?), und werden darin noch bestärkt, indem der Account als Sophie mit dem Publikum in Interaktion tritt. Aber auch hier sehen wir eine weichgespülte Sophie. Dass Sophie Scholl etwa auch mit ihrem christlichen Glauben haderte, dass das auch in ihrer Liebesbeziehung ein Thema war, blendet dieser Account zumindest bis dato (wenn ich nichts übersehen habe) ebenso aus wie die Tatsache, dass sie sich in just dieser Art Kommunikation möglicherweise überhaupt nicht wiedergefunden hätte. (Hört dazu auch die hervorragende Folge Herstory von Jasmin Lörchner!)
Wer Seifenoper macht, bekommt Seifenoper
Es besteht das Risiko, dass @IchBinSophieScholl am Ende zu einem Fandom wie jedes andere verkommt. Die Follower:innen suchen sich sich ihre Held:innen aus, mit der sie sich identifizieren – und können als Ergebnis einen differenzierten Blick gar nicht mehr einnehmen. Das Antworten „als Sophie“ ist dabei eine Steilvorlage dafür, dass Lesende die reale Sophie Scholl für sich vereinnahmen und den Schluss ziehen dürfen: „Sie ist wie ich, also wäre ich doch sicher auch wie sie gewesen.“
Genau das steht Deutschen aus Gruppen, die nicht aus antisemitischen oder rassistischen Gründen verfolgt worden wären (und zu denen ich auch gehöre) nicht zu. Die meisten waren eben nicht wie Sophie Scholl. Die unbequeme Wahrheit ist: Viele von uns wären die Mädchen gewesen, mit denen Sophie nichts anfangen konnte. Das anzuerkennen erfordert aber sicher mehr Mut als in einer demokratischen, wohlhabenden Gesellschaft „Fan“ einer Kunstfigur auf Instagram zu sein, die mit einer Widerstandskämpferin gleichgesetzt wird. Dass die Macher:innen von #IchBinSophieScholl es versäumen, diesen Moment des Befremden, dieses Anhalten zur Selbstreflexion – und sei es mit den sanftesten Methoden – zu vermitteln, ist mehr als nur eine vertane Chance.
Ohne Kurskorrektur dürfte uns dieser Ansatz in der Geschichtsvermittlung zum Nationalsozialismus eher zurückwerfen als nach vorn bringen.
***
Nachtrag: Leider sieht es nicht so aus, als wünschten SWR und BR eine Kurskorrektur. Ein Webinar der Friedrich-Naumann-Stiftung legt nahe, dass es den Macher:innen vorrangig um Klicks geht. Das Projekt richte sich an „junge Frauen“ – und die wollen offenbar keine Fußnoten? Oder wie ist die Auffassung von Historikerin Dr. Maren Gottschalk zu verstehen, Fußnoten seien auf Instagram eher störend?

